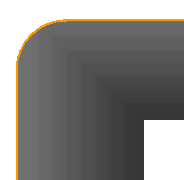Es ist wieder soweit. Peter Cornely läuft durch die Gänge des Hamburger Flughafens und muss für zwei Plattenkoffer und Gepäck erst einmal einen Wagen finden. Jetzt noch schnell zum Check-In. Die Durchsage beachtet er gar nicht. Peter Cornely hört nicht wirklich auf diesen Namen. Peter Cornely ist und heißt Karotte und auf dem Weg zu seinem Samstag. In seinem Club. Und da kann er seine Platten spielen. Und bestimmt auch Stücke von seinem ersten Album. Doch dazu später mehr...
Rückblende: 1969 wird vielen als ein Jahr in Erinnerung bleiben, in den die Mondlandung unser Bild von der Erde veränderte. Und kaum war Peter Cornely alias Karotte auf dieser Welt, überstürzten sich in den siebziger Jahren auch die Ereignisse. Daten speicherte man jetzt auf Floppy Disk, der Videorekorder wurde eingeführt, man flog im übergroßen Jumbojet und das erste Retortenbaby erblickte das Licht der Welt. In den USA regierte Richard Nixon, die Musikwelt erlebte das Ende der Beatles, den Tod von Elvis oder der Aufstieg von Bob Marley. Zu der Zeit entdeckte Peter Cornely seine Liebe zur Musik, und Ende der Achtziger Jahre führten die ersten Raves dazu, sich selber zwei Plattenspieler und ein Mischpult anzuschaffen. Schon schnell wurde er Resident-DJ in Saarländischen Clubs wie "Mirage", "Schwimmschiff" oder "Flash". Andere wichtige Clubstationen von Karotte wären das Space auf Ibiza, im Detroiter Motor-Club oder das Londoner "Ministry of Sound", wo er 1995 drei mal auf den damals angesagten Climax-Partys aufgelegte. Seine wohl wichtigste Homebase sollte aber Kassel's Club "Stammheim" / "Aufschwung Ost" werden. Zwischen 1994 und bis zu dessen Schließung im Jahr
2002 prägte Karotte als einer der Resident-DJ´s mit seinem stilistisch nie eingegrenzten Sound den beim Publikum wohl populärsten deutschen Club.
Sein markanter DJ-Name ist dabei immer noch für viele ein Rätsel und wenn er selbst mittlerweile behauptet, das er so getauft wurde, ist dies nur eine von vielen möglichen Antworten. Die Wahrheit rührt von seinem Tanzstil aus den Zeiten der Achtziger, von denen er den Spitznamen Hase wegtrug. Es bedurfte dann noch des ersten vegetarischen Restaurants im Saarland, um aus dem Hasen eine Karotte zu machen. Als Mitte 1993 im Magazin Groove unter seinen DJ-Charts dann tatsächlich Karotte stand, war dieser Titel einfach nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
Im Selbstverständnis sieht sich Karotte als DJ, der tanzbare elektronische Musik auflegt und dabei definitiv noch ein Entertainer ist. Diese Einstellung verfolgt er nun auch seit mehr als vier Jahren im Frankfurter Technoclub U60311, wo er an zwei Samstagen im Monat sein ganz eigens Programm spielen kann. Als einer seiner wichtigsten Grundregeln versucht Karotte nur in den Clubs aufzulegen, bei denen er mindestens alle zwei Monate vor Ort sein kann. So wie im Airport (Würzburg), Joue Joue (Erfurt), Loft (Ludwigshafen) oder im Flokati (München). Den Kontakt zu seiner Crowd sucht er aber auch noch auf anderen Wegen. Karotte ist seit zweieinhalb Jahren Resident bei der XXL-Clubnight vom Hessischen Rundfunk. Während er im Club eher spontan den Ablauf des Abends gestaltet, bereitet er sich für die XXL-Clubnight bewusst und beinahe penibel vor. Das richtige Gefühl für eine gute Auswahl an Tracks bewies er auch bei seiner Mix-CD für das U60311, die sich mit Tracks von Felix da Housecat bis 2Raumwohnung bisher mehr als zehntausend Mal verkaufte.
Abseits seiner täglichen Arbeit für die Booking-Agentur family affairs, seinen regelmäßigen DJ-Gigs und einem Final Scratch-Laptop hat sich Karotte eigene Tracks als neue eigene kreative Herausforderung ausgesucht. Zusammen mit Vernon Baur (Besitzer des Studios) und Ekim Stone (steht sonst hinter dem Projekt Tiefenrausch) produzierte er in der Nähe von Frankfurt als ersten Track "As It Comes", das beim Münchner Label Kosmo Records gleich unterkam und von John Acquaviva und Moonbootica mit Remixen veredelt wurde. Allein der ungewöhnliche Vocalpart beweißt, das Karotte bei seinen Produktionen wirklich neue Wege einschlägt. Dabei weiß er genau, woran das liegen könnte. "Natürlich ist etwas ganz anderes rausgekommen, als vorher vorgesehen. Ich spiele so viele verschiedene Styles durcheinander, so das in meinen Produktionen am Ende auch ganz viele verschiedene Elemente stecken. Dabei haben wir zuerst einfach nur angefangen und schon nach der zweiten Studiosession war die `As It Comes´ so gut, das ich dann meinen eigenen Namen darunter gesetzt habe. Das Album soll dann schon ein reines Clubalbum werden, aber in allen verschiedenen Variationen. Ich habe da keine Vorgabe und keine Eingrenzung. Ich bin ein Club-DJ und die Leute sollen bei mir tanzen!"

Richie Hawtin
1979 emigrierten Hawtins Eltern von England nach Windsor (Ontario). Sein Vater arbeitete in einer Autofabrik des General Motors-Konzern. Im Alter von 15 machte Richie Hawtin regelmäßig „Clubbing“-Ausflüge ins nahe gelegene Detroit, mit 17 war er bereits DJ in einem Club namens Shelter. Zusammen mit seinem Bruder Matthew Hawtin (ein visueller Künstler) teilte er sich zu dieser Zeit in Windsor eine alte Feuerwehr-Station. Richie Hawtin begann ein Studium der Filmwissenschaften in Windsor.
Über einen Kontakt mit Jeff Mills war Hawtin Ende der 80er Jahre erstmals auch als Produzent tätig. Anschließend hatte er bei dem Sender Detroit 96,3 FM eine eigene Radioshow, die zu seiner weiteren Popularität beitrug.
Mit John Acquaviva gründete er 1990 das in der Techno-Szene inzwischen legendäre Plus-8-Label. Ursprünglich wollte das Produzentengespann Hiphop veröffentlichen und so produzierte man anfangs noch für Kenny Larkin. Doch bereits 1991 erschien erstmals Acid Techno auf dem Label, meist von Hawtin, Acquaviva und Speedy J eingespielt. Damit wurde das Label stilbildend und lag im Trend. Binnen kürzester Zeit wurden konstante Verkaufszahlen von 10.000 Stück und mehr erzielt. Hawtin gründete 1991 noch die Labels Probe (für experimentellere Veröffentlichungen) und "Definitive" (für House Music). Gleichzeitig wurden er, Acquaviva und Speedy J international gefragt als DJs bzw. Live-Acts. Aufgrund seiner zahlreichen Verpflichtungen musste Hawtin sein Studium ohne Abschluss beenden.
Als Musiker und DJ nannte sich Hawtin nun auch Plastikman und Fuse, zusammen mit Fred Giannelli und Daniel Bell auch Spawn. Veröffentlichungen (überwiegend Maxi-Singles) folgten in großer Zahl und schneller Folge. Neben eigenen Produktionen machte sich Hawtin auch als Remixer einen Namen. Er setzte musikalische Akzente und arbeitete u.a. für Sven Väth, The Shamen, Josh Wink, Laibach, Steve Hillage und mit Pete Namlook.
Auf seinem Album „Sheet One“ (1993) verwob er Acid mit Ambient- und Minimal-Techno-Elementen. Die Songs sind experimentelle Klangcollagen aus TB-303-Läufen, Percussions und Effekten. Dieses Album hat in der Techno-/Electro-Szene einen legendären Ruf. 1995 erschien mit Hawtins „Call it what you want“ die 50. Veröffentlichung auf Plus8 Rec.
1995 gründete Hawtin mit seinem Bruder Matthew einen Intellinet genannten Vertrieb für insgesamt 15 Labels, der jedoch bald wieder eingestellt wurde. Infolge der Intellinet-Pleite wurden auch die Labels Probe und Definitive eingestellt. 1997 erfolgte nach über 70 Veröffentlichungen auch die Einstellung von Plus8. Das Label firmierte in der Folgezeit unter dem Namen m_nus.
Als DJ sind ihm die Plattenspieler nie genug, bzw. live ist Richie Hawtin mehr als Live-Act denn als DJ anzusehen, denn oft verwendet er zusätzlich Effekt-Geräte und nicht selten schließt er auch noch einen TR 909-Drumcomputer an. Eine solche Session wurde 1999 auf CD festgehalten: „Decks, EFX & 909“. Zusammen mit John Acquaviva nutzte er als erster DJ die Software Final Scratch zum Mixen.
Im Jahr 2000 erschien mit „Plus8 Classics“ eine Retrospektive auf die siebenjährige Labeltätigkeit.
2001 präsentierte sich Hawtin wieder experimentell: Mit „DE9: Closer to the Edit“ legte er ein Album vor, das aus unzähligen kleinen Sound-Schnipseln von über 100 Techno-Produktionen zusammengesetzt wurde und so zur Hälfte eine Eigenproduktion und zur Hälfte einen DJ-Mix darstellt.
Von 2002 bis 2003 lebte Hawtin in New York City, ab 2004 in Berlin. In Deutschland begann eine intensive Zusammenarbeit mit Ricardo Villalobos, mit dem er ein erfolgreiches DJ-Gespann bildet und in dessen Projekt Narod Niki er ebenfalls mitarbeitet.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2005 schuf Hawtin gemeinsam mit dem Mailänder Choreografen Enzo Cosimi den Titel „9:20“ für die Eröffnungsgala der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin. Es handelte sich dabei allerdings um eine verlängerte Fassung des 1991 unter seinem Projektnamen F.U.S.E. erschienen Stücks „Substance Abuse“ - fraglos als neckische Anspielung auf die Dopingproblematik im Hochleistungssport gewählt.
Im März 2006 war in Berlin die Ausstellung min2max zu sehen, in der laut Pressetext „mit einer ästhetischen Minimalität der Quader im Raum mystifiziert wird“. Das Ausstellungskonzept lieferte Matthew Hawtin, Richie Hawtin hat minimalistischen Soundtrack dafür produziert

Ricardo Villalobos
Ricardo Villalobos wurde in Chile geboren und kam mit drei Jahren nach Deutschland, nachdem seine Eltern infolge des Militärputsches Chile verlassen mussten. Die Familie siedelte sich in der Nähe von Darmstadt an, die Eltern arbeiteten auf dem Frankfurter Flughafen. Früh begeistert sich Villalobos für Musik. Sein Vater war ihm nach seinen Angaben ein wichtiges Vorbild und Mentor, durch ihn lernte er viele Musikrichtungen kennen: den im familiären Freundeskreis geschätzten Salsa, aber auch Rock und elektronische Musik. Bereits als Jugendlicher erlernte er das Trommeln mit Congas und spielte live auf Tanzveranstaltungen der Freunde des Vaters, die eine Veranstaltungsagentur betrieben. Der Vater war es auch, der den 15-jährigen Ricardo erstmals in die damals legendäre Disco "Dorian Gray" im Frankfurter Flughafen mitnahm.
1988 stand Ricardo das erste Mal als DJ hinter dem Pult einer Disco, nachdem er schon auf einigen Schul- und Kellerpartys sein Können unter Beweis gestellt hatte. Er begeisterte sich damals für Depeche Mode und begann auch, eigene Musik in deren Stil aufzunehmen. Zu Beginn der 90er Jahre begeisterte sich Villalobos für den aufkommenden Acid-House, der nun seine DJ-Sets und seine eigenen Aufnahmen prägen sollten. 1992 debütierte er mit einer Maxisingle auf dem "Overload"-Label und veranstaltete illegale Technopartys, die ihn überregional bekannt machen sollten. Seine ebenfalls zu dieser Zeit gegründeten eigenen Labels "Elastic Music" und "Plastic Flavour" hatten jedoch keinen Erfolg und wurden bald darauf wieder eingestellt.
1994 wurde er von den Machern des Ongaku-Labels eingeladen, während eines großen Festival während der Sonnenfinsternis in Chile aufzulegen. Dadurch wurde Villalobos in seiner alten Heimat bekannt, wo er künftig, speziell während der deutschen Wintermonate, regelmäßig auflegen sollte. 1995 wurde er Resident-DJ im Frankfurter "Box", später auch im legendären "Omen". Weitere Plattenveröffentlichungen folgten. 1997 begann er, regelmäßig in Clubs auf Ibiza aufzulegen, wo er spätestens 1999 bei den "Cocoon-Clubbing-Events" von Sven Väth die Ihren Ursprung im Frankfurter Techno-Club U60311 haben und als Resident bei der Qualitätssause mit der der elektronische Festivalsommer in Deutschland seit 2003 traditionell schließt, der Green & Blue, in die erste Riege nationaler DJs aufstieg.
Im Sommer 2003 erschien seine Mix-CD »Taka Taka«, und im Herbst 2003 legte Villalobos mit »Alcachofa« auf Ongaku Rec. erstmals auch ein eigenes Album vor, das eine durchweg positive Presseresonanz erfuhr. Anfang 2005 folgte sein zweites Album unter dem Namen "Thé au Harem d’Archimède" auf Neuton Rec. Die Eigenproduktionen von Ricardo Villalobos lassen sich keinem klaren Genre zuordnen. Auf seinen Alben sind sowohl Einflüsse von Acid House und Minimalismus, gleichermaßen aber auch südamerikanische und ballearische Anklänge zu finden. Im Herbst 2006 erregte Villalobos mit der Veröffentlichung des rund 37 Minuten langen Tracks "Fizheuer Zieheuer" Aufsehen.
Villalobos, inzwischen in Berlin beheimatet, gründete auch das Projekt "Narod Niki", in dem acht bekannte DJ-Größen gemeinsame Livesets nur mit ihren Laptops bestreiten, darunter u.a. Richie Hawtin, mit dem Villalobos bereits seit Beginn seiner DJ-Tätigkeit auf Ibiza immer wieder zusammenarbeitet.

Dj Rolando
DJ Rolando (eigentlich Rolando Ray Rocha) ist ein US-Amerikanischer Techno-DJ und Musiker aus Detroit.
Rocha wuchs zwischen lateinamerikanischen Einwanderern inmitten von Detroit auf. Später lauschte er den Mixes von Jeff Mills im Radio, der damals noch "The wizard" heißt. Durch einen Freund wurde er Mike Banks vorgestellt, der ihn schließlich zu einem Mitglied von Banks Label und Musikprojekt Underground Resistance macht.
Unter dem Pseudonym The Aztec Mystic gelang Rocha 1999 mit dem Techno-Track Jaguar auf dem Label Underground Resistance der Durchbruch. Der Track war zunächst ein Underground Hit, entwickelte sich aber letztendlich zu einem Klassiker der Technoszene.
Das Majorlabel Sony (und BMG, welche das Stück lizenzierten) interessierte sich für eine Veröffentlichung des Tracks "Jaguar" im großen Stil. Underground Resistance lehnten dies aus Überzeugung ab, es erschien aber dennoch eine Coverversion inkl. Videoclip ohne Zustimmung. Weltweit überfluteten daraufhin viele Mails von Underground-Resistance-Sympathisanten den Sony-Mailserver und legten ihn lahm. Die bekanntesten DJs der Welt unterstützten das Original in der so genannten "Condition red" (dt. Alarmstufe rot). Sony zog letztendlich die europäische Veröffentlichung kleinlaut zurück, veröffentlichte jedoch das "Jaguar"-Cover weiterhin in Südamerika.

Alter Ego
Alter Ego ist der Name eines Musik-Projektes von Jörn Elling Wuttke und Roman Flügel. Ihre Produktionen bewegen sich auf dem weiten Feld zwischen Techno, Electronica und experimenteller Musik.
Jörn Elling Wuttke und Roman Flügel arbeiten bereits seit den späten 80er-Jahren als Produktionsteam. 1993 gründeten sie mit DJ Ata und Heiko MSO die drei Labels Ongaku, Klang Elektronik und Playhouse.
Ebenfalls 1993 wurde das Projekt "Alter Ego" gegründet. 1994 erschien die erste Alter Ego-EP auf Sven Väths Label Harthouse, mit dem das Duo innerhalb der Szene viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Bereits 1995 erschien das Nachfolgealbum "Decoding the Hacker Myth". 1997 wurde mit "Absolute" die letzte Alter Ego-Single auf Harthouse veröffentlicht. 1999 erschien der Track "Betty Ford", der einer der größten Club-Hits des Jahres wurde. Der 2004 erschiene Track "Rocker" bescherte den beiden 2005 den Dance Music Award für den besten Track.
 +
+  =
= 
Jörn Wuttke Roman Flügel Alter Ego
Ellen Allien
Ellen Allien (* in Berlin; eigentlich Ellen Fraatz) ist Techno- und Electro-DJ, Musikproduzentin, Veranstalterin und Labelinhaberin von BPitch Control.
1989 lebte Ellen Allien ein Jahr lang in London und kam dort in Kontakt mit elektronischer Musik. Als sie nach Berlin zurückkehrte, begann in Deutschland gerade die Techno-Welle.
1992 arbeitete sie im Fischlabor und begann sich für die Arbeit der DJs zu interessieren. Später wurde sie Resident DJ im Bunker, Tresor und im E-Werk. Parallel dazu hatte sie auf dem Radiosender Kiss FM ihre eigene Show gründete ein eigenes Plattenlabel; beides trug den Namen "Braincandy". Aufgrund von Unstimmigkeiten mit Plattenvertrieben gab sie Braincandy 1997 auf und veranstaltete stattdessen Partys mit dem Namen "B Pitch".
1997 gründete sie das Label BPitch Control auf dem 2000 das erste Release erschien. Mit Veröffentlichungen von Sascha Funke, Paul Kalkbrenner und Tok Tok wurde das Label sehr erfolgreich und in ganz Europa bekannt.
2001 veröffentlichte Ellen Allien ihr erstes Album: "Stadtkind". 2003 folgte "Berlinette".
2005 erschien im Mai ihr neues Album "Thrills".
2005 neu unter-label "Memo" : minimal techno mit Ben Klock, Zander Vt.
2006 entstand gemeinsam mit Apparat das Album Orchestra of Bubbles auf BPitch Control.

Monika Kruse
Monika Kruse ist 1971 in Berlin geboren, allerdings in München aufgewachsen. Seit sie als siebenjähriges Mädchen mit Klavierunterricht begann, war Musik ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Nach ihrem Abitur war sie unter anderem bei einem Musikmagazin und einer Bandpromotionfirma als Praktikantin tätig. Nebenher arbeitete sie als Fotomodell und verdiente so genug Geld, um sich eine umfangreiche Schallplattensammlung zuzulegen. Später nahm sie eine Stelle als Produktmanagerin bei der Plattenfirma Chrysalis an, wo sie bekannte Acts wie Gang Starr oder Monie Love betreute.
1991 trat sie zum ersten mal als DJ auf: in der Münchner Bar "Babalu". Die musikalische Stilrichtung war vor allem geprägt durch Hip-Hop und Funk, ihr Set beinhaltete aber auch erste Housenummern. Kurze Zeit später wurde sie Resident DJ im "Parkcafé".
Ende 1993 wurde Monika Kruse Mitglied der Ultraworld-Crew, die Techno-Partys in München veranstaltete und 1994 den Ultraschall-Club eröffnete. Kruse war von Anfang an Resident im Ultraschall.
1995 versuchte sich Kruse an ersten eigenen Produktionen. Eine Coproduktion mit Richard Bartz (Acid Scout) wurde im Frühling auf einer Compilation veröffentlicht. Monika Kruse nahm außerdem einen Job als A&R bei Kurbel-Records an. Als DJ hatte sie inzwischen bereits Auftritte in London, Stockholm und Chicago. Im Sommer 95 organisierte sie die erste Housetram-Party, die in einer Straßenbahn stattfand.
Ende 1997 erschien ihre erste Solo-Produktion auf einer Compilation. Im selben Jahr zog sie nach Berlin um. Im Herbst erschien ihre erste Mix-CD. 1998 folgten einige Coproduktionen mit Patrick Lindsey.
1999 erschien ihre zweite Mix-CD. Ein Jahr später gründete sie ihr erstes Label "Terminal M". Im selben Jahr legte sie bei der Schlusskundgebung der Love Parade vor 1,5 Millionen Menschen auf. Im Oktober erschien ihre dritte Mix-CD, diesmal auf ihrem eigenen Label.
2001 erschien das erste Album ("Panorama"), das sie zusammen mit Patrick Lindsey produziert hatte.
2003 gründete sie ihr zweites Label "Electric Avenue Recordings", dessen Veröffentlichungen sich mehr im Bereich der ruhigen elektronischen Musik befinden. Monika Kruses Veröffentlichung "Latin Lovers" wurde zu einem Sommerhit, erreichte in Spanien die Top Twenty der Media-Control-Charts und wurde in den Niederlande zur Nummer 1 der Dance-Charts. Im Herbst erschien ihr zweites Album ("Passengers").

Dj Rush
DJ Rush (* in Chicago, als Isiah Major) ist ein erfolgreicher Techno-DJ und Musikproduzent.
In der aufblühenden House-Szene Chicagos fand DJ Rush schnell gefallen an elektronischer Musik. Seine ersten Auftritte als DJ hatte er in der "Music Box", dem "Powerhouse", dem Stammheim und dem legendären Warehouse, wo er bis zu 10 Stunden am Stück hinter den Plattentellern stand. Gleichzeitig begann er in seinem Schlafzimmer mit der Produktion eigener Kreationen.
1991 veröffentlichte Rush auf dem Label Trax Records seine erste Single ("Knee' Deep"). Seine Produktionen wurden zunehmend minimaler und härter und er begann in London und Berlin Fuß zu fassen. Er kam unter anderem bei Force Inc und Djax up Beats unter Vertrag.
1998 gelang DJ Rush mit der Platte "Motherfucking Bass" der europaweite Durchbruch. 2001 löste er bei den Leserwahlen des Groove-Magazins Jeff Mills als beliebtesten DJ ab.
In letzter Zeit hat er sich mehr und mehr aus der aktiven Szene zurückgezogen und gibt nur noch selten Auftritte, da er sich mehr um seine Familie kümmern will.
Er gilt als Vorreiter des heutigen Hardtechno, wobei er sich selbst damit nie identifiziert hat. Er nennt seinen Style selbst "Energy".

Dominik Eulberg
In den frühen Morgenstunden kann es schon mal vorkommen, dass man Dominik Eulberg alleine und lediglich mit einem Spektiv bewaffnet, am schilfbewachsenen Seeufer stehen sieht. Dort, wo niemand ihn stört, geht er seinem Hobby nach: Vögel beobachten. Ist der leidenschaftliche Ornithologe einmal nicht seinen gefiederten Freunden auf der Spur, sitzt er am Computer und produziert Technomusik. Dominik Eulberg erblickte 1978 das Licht der Welt im wunderschönen Westerwald, wo er im Einklang mit der Natur aufwächst. Danach verschlägt ihn der berüchtigte Westerwälder Wind in die Bundesstadt Bonn, wo er beginnt ökologische Geografie zu studieren. Natur ist neben der Musik der wichtigste Bezugspunkt für ihn. Begeisterter Naturfreund ist er auch, wenn er an neuen Sounds arbeitet. Allerlei Naturgeräusche fächern das Klangrepertoire seiner Lieder auf, und geben den Tracks einen organisch, lebendigen Charakter. Ob Froschgequake oder Vogelgeschnatter, Dominik Eulberg findet für seine singenden Tiere stets ausreichend Platz in seinen Liedern. Man schaue sich dazu allein schon seine Tracktitel wie: „Basstölpel“, „Die Trottellummen von Helgoland“ oder „Die Rotbauchunken vom Tegernsee“ an.
Dominik Eulbergs Faszination für elektronische Musik beginnt schon in sehr jungen Jahren. Mit Freunden lauscht er stets den so mysteriösen Klängen der Sven-Väth Clubnights. Einmal in den Bann gezogen, lässt es ihn nicht mehr los.
So beginnt er im Alter von 15 Jahren Platten zu kaufen und das Auflegen zu erlernen. Dabei richtet er schon von beginn an sein Augenmerk auf innovative, experimentelle Platten.
1995 legt er sich dann einen eigenen Gerätepark zu, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und diverse Live-Auftritte abzuliefern.
Erste Veröffentlichungen kommen auf Mathias Schaffhäusers Label Ware und auf dem Frankfurter Label Raum...Musik heraus. Dann lernt er Riley Reinhold und Jacquline Klein kennen und eine fruchtbare Kollaboration entsteht auf den Labels Traumschallplatten und Trapez. Dort erscheint auch sein erstes Album „Flora & Fauna“. Weitere Veröffentlichungen auf Platzhirschschallplatten, Cocoon etc. kommen hinzu.
Auch als Remixer hat er sich einen Namen gemacht und so namhafte Künstler wie Hell, Roman Flügel, Le Dust Sucker, Tiefschwarz, Einmusik oder Nathan Fake in die akustische Mangel genommen.
Dann ging alles sehr schnell. Von dem elektronischen Fachmagazin Groove wurde er zum Newcomer des Jahres 2004 gewählt und zum drittbesten Produzenten. Sein Debütalbum „Flora & Fauna“ wurde bei den Leserumfragen der Zeitschrift Raveline zum drittbesten, in der Groove und De:Bug jeweils zum fünftbesten Album des Jahres 2004 ernannt.
Auch für den Deutschen Dance-Music-Award wurde Dominik Eulberg 2004 in den Kategorien „Bester Remix“ und „Bester Newcomer“ nominiert.
2005 wurde Dominik Eulberg in der Groove zum Produzenten des Jahres und zum drittbesten nationalen DJ gewählt. Außerdem landeten gleich fünf seiner Remixarbeiten in den Top20 der Jahrescharts. In der Raveline wurde er zum zweitbesten Remixer und Newcomer gewählt, auch sein Remix für Oliver Koletzki landete auf Platz 2. Zudem wurde er zum viertbesten Act und zum fünftbesten nationalem DJ gewählt.
2006 wurde Dominik Eulberg in den Kategorien "Bester Produzent" und "Bester Remix" erneut zweimal für den Deutschen Dance-Music-Award nominiert.

John Acquaviva
John Acquaviva ist ein Techno/House DJ, der den Stil maßgebend mitgeprägt und innerhalb dieses Genres einige kleine Revolutionen (vor allem im Bereich der technischen Hilfsmittel) ausgelöst hat.
Geboren wurde John Acquaviva in Süditalien.
1967 wandern seine Eltern nach Kanada aus. Seither lebt er in London, Ontario.
1980 beginnt er mit dem Plattenauflegen, zunächst auf Schulpartys, dann auch auf House Partys.
1989 trifft er auf Richie Hawtin. Beide verbindet der Enthusiasmus über die elektronische Musik aus Detroit. Gemeinsam gründen sie das legendäre und stilbildende Plus-8-Label aus Kanada. Künstler wie Speedy J, Kenny Larkin, Cybersonik (John Acquaviva, Richie Hawtin und Daniel Bell), F.U.S.E. und Plastikman (beide Richie Hawtin) veröffentlichen Meilensteine auf Plus-8.
Mitte der 90er wird John Acquaviva als DJ immer gefragter und spielt auf der halben Welt. Richie Hawtin geht es schon länger so, so dass sie beschliessen, das Label Plus-8 ruhen zu lassen, da sie ihre Ziele erreicht haben.
Um die Jahrtausendwende hört John Acquaviva erstmals von Computerfreaks, die über Plattenspieler MP3s ansteuern und abspielen wollen. Er nimmt Kontakt auf und ermutigt sie in diesem Unterfangen. Einige Zeit später darf er den Prototypen testen und ist begeistert. Final Scratch heißt das Konzept und besteht aus zwei Platten mit dem Steuersignal, einem A/D Wandler-Modul und der Software, die die MP3s so abspielt, wie sie als Platte klingen würden.
Laurent Garnier
Laurent Garnier (* 1. Februar 1966) ist ein französischer Technoproduzent und DJ.
Garnier machte zunächst eine Ausbildung zum Koch und arbeitete unter anderem in Manchester, wo er während der 80 Jahre den Hype um das Genre des Acid House miterlebte und seine Tätigkeit als DJ begann. Als DJ des Clubs The Haçienda in Manchester war Garnier in den späten 1980ern und zu Beginn der 1990er Wegbereiter der so genannten Madchester-Szene.
Seit Mitte der 1990er setzt Garnier Schwerpunkte seiner Arbeit als Musikproduzent und mit der Veröffentlichung von Studioalben im House-Genre. Er ist weiterhin der Autor mehrerer Bücher, die sich mit der Geschichte der elektronischen Musik und seiner Tätigkeit als DJ beschäftigen.
Johannes Heil
Johannes Heil (* 3. Februar 1978) ist ein deutscher Produzent und Live-Act im Bereich der elektronischen Musik.
Seine musikalische Karriere beginnt in dem Bad Nauheimer Technobistro "Kanzleramt", welches zu jener Zeit Heiko Laux gehörte. Er veröffentlichte seit 1995 auf diesem Label verschiedene Produktionen, unter anderem seine erste Debutsingle "Die Offenbarung". Mit Heiko Laux arbeitete er anfangs unter dem Pseudonym "Item One" und veröffentlichte ebenfalls auf Kanzleramt Records einige LPs. Weitere 12" folgten auf Labels wie Uturn, Creation Rebel, Kobayashi und Fieber. Kommerziell erfolgreich (im Sinne von Musikvideos auf den unterschiedlichen Musikkanälen) wurde Heil zuletzt mit der Singleauskopplung "Dein Schweiß" aus Sven Väths Album "Contact". Dank einiger Produktionen mit dem aus den USA stammenden "DJ Slip" hat er auch dort seine Duftnote hinterlassen.
Chris Liebing
Christoph Liebing (* 11. Dezember 1975 in Gießen, Deutschland) ist ein deutscher Techno-DJ, Produzent, Label-Betreiber und Radiomoderator.
Er spielte bereits auf Dance-Veranstaltungen wie der Loveparade, Mayday, Nature One und Time Warp. Bei den deutschen Dance Awards wurde er mit Titeln wie bester nationaler DJ und bester Produzent ausgezeichnet. Liebing gründete 1996 das deutsche Technolabel Fine Audio Recordings, auf welchem viele Platten von ihm veröffentlicht worden sind wie auch sein erstes Album Early Works am 29. April 2002. Im Juni 2003 erschien dort sein zweites Album Evolution. Er prägte maßgeblich den Szene-Begriff Schranz.
Anthony Rother
Anthony Rother (* 29. April 1972 in Frankfurt am Main) ist ein deutscher Electro-Musiker und Begründer der Plattenlabel psi49net, Stahl Industries und Data Punk.
In seinen Werken lässt sich ein starker Einfluss der Gruppe Kraftwerk und des frühen Detroit Techno erkennen. Für Aufsehen sorgte seine Neuinterpretation der Kraftwerk-Titel Trans Europa Express und Nummern / Computerwelt. Neben seinen eigenen Produktionen unter verschiedenen Pseudonymen ist Rother ebenfalls ein gefragter Remixer.
Seine erste Band gründete Rother 1988. Durch die Bekanntschaft mit Heiko Laux hatte Rother die Möglichkeit seine erste Platte bei dessen Label Kanzleramt Records zu veröffentlichen.
In früheren Alben setzte sich Rother oft mit technologischen Phänomenen wie Biotechnologie und Hacking auseinander. Durch die Integration vocoderisierter Texte ("Biomechanik, das Leben wird kopiert, Gefühle generiert, Natur perfektioniert"; in Biomechanik) und Zitate (z.B. einen Tagesschau-Bericht über Datendiebstahl; in Protektor) zeigt sich Rother ansatzweise technologiekritisch und stellt damit eine Besonderheit in der als hedonistisch und technologiebegeistert geltenden Techno-Szene dar.
Sein 2004 erschienenes Album Popkiller ist eine Mischung aus Synthiepop und Neoelectro und wurde von einigen Fans aufgrund der relativ belanglosen Vocoder-Texte zwiespältig aufgenommen. Trotzdem wurde es von den Lesern der Zeitschrift Groove als drittbestes Album des Jahres 2004 gewählt. In den Umfragen des Magazins wird Rother auch seit mehreren Jahren kontinuierlich als einer der besten deutschen Techno-Liveacts gewählt.
Entgegen einem besonders im Internet kolportierten Gerücht ist Anthony Rother nicht der Sohn des ehemaligen Kraftwerk-Mitglieds Michael Rother.
Rother wohnt derzeit in Friedberg (Hessen).